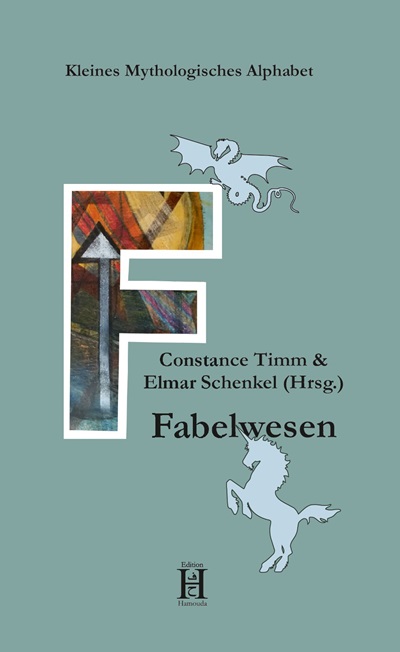Die Tierschicht Hans Findeisens
Im Tanz um das getötete Jagdwild sucht der Paläolithiker „Befreiung von der Last des Tötenmüssens“, so hat es Hans Findeisen (1903-1968), der große Religionsethnologe und Sibirienforscher, in seiner kleinen Schrift „Das Tier als Gott, Dämon und Ahne“ formuliert. Die monotheistischen Religionen seien am Widerspruch zwischen Vernichten und Verehren gescheitert; deswegen spiele das Tier in den am weitesten verbreiteten Sakralschriften – sehen wir einmal vom „Lamm Gottes“ ab – kaum eine Rolle. Und in der zweitausendjährigen Geschichte des Christentums wurde die über zehntausend Jahre gepflegte Mensch-Tier-Beziehung als Wechselverhältnis in das Souterrain der Kultur verbannt. Hieraus aber meldet sie sich immer wieder. Findeisen zitiert dazu den romantischen Dichter Justinus Kerner (1786-1862):
„… Es gibt Geister, die ganz Tiere sind, die in Hundsgestalten etc. erscheinen…Es gibt Menschen, deren Geistiges durchaus das einer Sau ist. Fällt ihr Körper weg, so kommt die Sau, der Saugeist heraus, der sich dann auch als Sau figuriert und auch so für einen, der Geister sehen kann, sichtbar wird. Es laufen viel mehr Tiere in Wäldern und Feldern, die ehemals sogenannte Menschen waren, als Tiere, die wirklich Tiere sind, darin laufen. Erstere uns unsichtbar, letztere uns natürlich sichtbar. Dies sind reine Wahrheiten.“
Wandernde Seelen und sich verwandelnde Geister – die Grundsubstanz aller Weltreligionen außerhalb des dominanten Stammes Abraham – sind nach Findeisen die Bindeglieder zwischen Mensch und Tier und so auch die Bindeglieder zwischen der ältesten Religion, die er „Tierschicht“ nennt, und allen späteren Kosmologien, Mythologien oder Dogmatiken, sofern diese hier nicht überhaupt mit Denkverboten operieren. Wo Religion dagegen Phantome, Fantasien und Phantastereien zulässt oder fördert, eröffnet das uralte Interaktionsfeld zwischen Mensch und Tier einen ungeheuren Reichtum, der im Bärenkult der Nordhalbkugel, im Walfischkult der Küstenbewohner (so im nördlichen Pazifik), im Krokodilskult der Tropen oder in Vogel- und Affenkulten der Waldbewohner (wie im Amazonas-Gebiet), vor allem aber in den Schlangen- und Drachenkulten weltweit vom chinesischen Lung bis zum alpinen Tatzelwurm reiche Blüten ausgetrieben und die Schatztruhen der Religionsethnologie gefüllt hat. Nach Findeisen liegt in diesem Reichtum der Grund für die „Nachhaltigkeit“ oder „Resilienz“ der Tierschicht:
„Das Überlieferte scheint demnach eine Macht zu sein, der sich alle Reformationen und Neuerschließungen, wie z.B. das Schamanentum und die Lehre Buddhas, anpassen müssen. Vielleicht ist es tröstlich, zu sehen, wie zähe die Menschheit an einmal geschaffenen Formen festhält, und wie wenig gewillt sie ist, sich Neuerungen ihrer geistig-seelischen Erlebnismöglichkeiten zu unterwerfen. Immer wieder brechen sich die altüberlieferten Vorstellungen Bahn und verändern den neuen Gedanken, zwingen ihn zumindest, sich der Sprache der älteren und vielleicht bekämpften Systeme zu bedienen. Meist ist das Neue überhaupt nur eine Variante des schon Bestehenden, wie wenn anstelle der Tiere – etwa im christlichen Kulturkreis – nunmehr nur noch die Menschen einer Wiederauferstehung für wert erachtet werden.“
Auch die erstrebte Reinigung von der Blutschuld, ein zentrales Thema im christlichen Sündenkomplex, führt Findeisen auf die oben genannte Angst vor der Rache des Getöteten zurück. Noch in den Opferkulten, die sich von der Notwendigkeit des Fleischgewinns entfernt haben können, spielt das „Beschwichtigen“ und „Begütigen“ des Opfertieres eine bedeutsame Rolle, ist oft Kern des „altmenschlichen ‚Theaters‘“, in dem ja häufig der Geopferte selbst zum Sprechen und Singen kommt, wie es der berühmte Gesang vom Bärentod bei den Ostjaken (Chanten) am Ob dokumentiert.
Die Religionsgeschichte ist nach Findeisen eine sukzessive Ausschaltung des Tieres aus dem Heilsgeschehen; kennen die Hackbauern noch den Wert tierlicher Verbündeter in ihren Totemverbänden und Opferzeremonien an und eröffnen die Hirtenkulturen ganz neue Wege des „Tierdenkens“, beginnen die Pflugbaukulturen aber deutlich mit dem Abbau der Tierpräsenz in Mythos und Kult, möglicherweise weil nun das Tier zum Last-, Zug- und Reitdienst funktionalisiert wurde. Eine rühmliche und bestens überlieferte Ausnahme macht die ägyptische Antike, die Findeisen als „Museum der Tierschicht“ preist, in der heilige Tiere in Tempeln verwöhnt wurden, wo sich Pilgerorte nach „Totemtieren“ nannten und sich gegenseitig Konkurrenz machen konnten.
Verglichen mit den philanthropischen Reinigungswerken Judentum, Christentum und Islam, bleiben aber alle archaischen Hochkulturen tief mit der Tierschicht verbunden. Findeisen erwähnt die Wasser- und Weisheitsgottheit Ea von Eridu im Zweistromland, die oft als Fisch dargestellt wurde, und die weltgeschichtlich einmalige Kreation des Tierkreises, der wie die die Wochentage benennenden Planetengötter babylonischen Ursprung besitzt. Im alten Griechenland erschienen Tiergötter noch als Schlange des Heilgottes Asklepios, Athena war die Eule zugeordnet und der Muttergöttin Hera die Kuh, der Pfau oder die Gans. Auch die alten asiatischen Religionen seien tierschichtlich geprägt; Findeisen führt die Verbindung der heiligen Kuh mit der hinduistischen Seelenwanderung an, die überragende Bedeutung des Drachens in China und die Füchse wie Karpfen betreffende Tiergeistbesessenheit Japans. Nach den Ausführungen des Arabisten Henninger kannten auch die vorislamischen Araber unblutige Tierweihen und kultische Tierhaltungen ebenso wie viele afrikanische Kulturen die alte Tierschicht in bis zur islamischen oder christlichen Missionierung gepflegten Tierverkleidungen, Tiertänzen, Tierbesessenheiten und Wer-Glauben bewahren konnten. Erst die neuzeitliche Entzauberung der Mitwelt gab den Weg zum instrumentellen Umgang mit dem Tier frei. In Fortführung der Gedanken Findeisens gehören heute die meisten afrikanischen, asiatischen und amerikanischen Gesellschaften einer globalen Industriewelt an, in der auch der einstmals existenziell zu bewältigende Tötungsakt dem Fließband überantwortet ist. Die Verwandlung des Mitlebewesens Tier zum Nahrungsmittel Fleisch ist damit weitgehend aus der religiösen Erfahrung ausgeschlossen worden. Ernährungswissenschaftler begrüßen diesen Rationalisierungsschritt, erlaubt er doch die Versorgung ganz anderer Bevölkerungszahlen als es tierverehrenden Gemeinschaften bis vor kurzem möglich war.
Ergriffenheit und Besessenheit
Der japanische Philosoph Toshiaki Kobayashi hielt nach der Jahrtausendwende an der Leipziger Universität einen Vortrag über kitsune-tsuki, die Fuchsbesessenheit, die in bestimmten Familien erblich sei. Überall in Japan zeugten Fuchsschreine, Fuchsfeuer und Fuchstalismane von dieser weitverbreiteten Tierreligion in einer der modernsten Industriegesellschaften. Kobayashi schloss seine aufschlussreichen Ausführungen mit der Überlegung, dass die archaische Tierbesessenheit im modernen Kontext Konkurrenz bekommen habe: „Besessenheit“ durch den Kaiser und durch den Nationalstaat. Beide forderten ebenfalls bedingungslose Hingabe und Opferbereitschaft bis zum Tod. Der Mensch erscheint unter der hier genannten Perspektive als ein Gefäß, das gefüllt werden muss. Der deutsche Sprachgebrauch kennt für diesen Vorgang die Begriffe Enthusiasmus und Begeisterung.
In ersterem Falle ist es die Gottheit (theos), in letzterem sind es die Geister, die die Füllung vornehmen. Die Grenzen zur Pathologie sind undeutlich. „Der Höhenschwindlige ist vom Abgrund ergriffen“, schreibt der Schweizer Philosoph Jürg Zutt in der Einleitung zum interdisziplinären Gespräch „Ergriffenheit und Besessenheit“. Das Anschauliche, das in diesem Zusammenhang vom lebendigen Tier, dem fantastischen Fabeltier oder vom grotesken Mischwesen repräsentiert wird, übt eine unheimliche Macht aus, die zu einer Verquickung von Angst und Rausch führen kann. Allen Tierkulten liegt das Überwältigtsein durch eine nicht messbare und damit unbeherrschbare Macht zugrunde. Im weit verbreiteten Glauben an den Bösen Blick bewegt sich diese existenzielle Fixierung noch auf „Augenhöhe“, beim Tier muss man hinab oder hinauf schauen, um den Schrecken wahrzunehmen.
In den weltweit beobachteten Besessenheitskulten antwortet der in Trance „Fallende“ durch eben diesen „Fall“. Was die Medizin dann „Fallsucht“ nannte (z.B. Kretschmer), ist religionspsychologisch die allen sichtbare Verwandlung, die die Besessenheit ausdrückt. Es liegt nun an der Versiertheit der „Profis“ in solchen Gemeinden, aus dem „Außersichsein“ zu einer Art Kontrolle zurückzufinden und von der fremden Macht zu profitieren. Das ist der Beginn des Schamanismus, der tief in der Tierschicht wurzelt, sie aber nicht gänzlich abdeckt.
Die weltweit verbreitete Besessenheit durch das Tier liegt auch vor einer Unterscheidung zwischen guten und bösen Geistern, die die sogenannten Hochreligionen beflügelt, bis im Spiritismus des 19. Jahrhunderts wieder ein Verständnis für die Macht der Ambivalenz zurückgewonnen werden konnte. Die Einsichten von Theosophie und Anthroposophie erleichterten so das Verständnis der Stammesreligionen, die die Ethnologie damals zu erforschen begann.
Die entscheidende Voraussetzung für den geistigen Nachvollzug von Tierbesessenheiten scheint die Infragestellung des autonomen Ichs zu sein, das in der abendländischen Apotheose der Subjektivität und der Überwindung des Bildes durch den Text gipfelte – beim Berliner Religionsphilosophen Jacob Taubes (1923-1987) der Sieg des jüdischen Ohres über das griechische Auge. Tiergeistbesessenheit ist ein Menschheitserbe, das den neuzeitlichen Geisteskämpfen lange vorausgeht. Ergriffene und Besessene trachten nicht nach Exorzismus, eher nach Teilhabe, nicht nach Wiederherstellung der Subjektivität, eher nach Heteronomie im Ganzen. Tiergeistkulte feiern das Tier in seiner Reinkarnation, und die betroffenen Personen gelten als „des Gottes volle“ (griech. entheoi). Sie sind für ihre Taten nicht mehr verantwortlich zu machen, weil die Gottheit oder das Tier in ihnen tobt.
Über die Wolfsbesessenheit oder Berserkerwut im alten Europa schreibt der Schweizer Germanist Martin Ninck:
„Die Berserkerwut ist bekanntlich ein Anfall rasenden Zorns. Vorauszugehen pflegt ein schläfriger Zustand. Die Ergriffenen schlagen um sich, verwandeln sich in Wölfe oder Bären, die unter ihren Feinden wüten, während ihre Körper schlafend daliegen. Sie verschlucken glühende Kohlen und schreiten über Feuer, ohne versehrt zu werden; sie halten sich überhaupt für unverwundbar.“
Mit diesem auf Besessenheit gründenden Unverwundbarkeitsglauben haben sich germanische Kriegerbünde auf den Gegner ebenso wie afrikanische Antikolonialisten ins Gewehrfeuer gestürzt.
Die zur Hieromanie gesteigerte Hierophanie ermöglicht übermenschliche Anstrengungen, das Tier macht den Menschen zum Übermenschen. In den Stifterreligionen reduziert sich dieser psychische Ausnahmezustand meist auf die Person des Stifters selbst. Der Prophet Mohamed lebte von seinen Visionen und Ekstasen, die seine Gottesnähe bezeugen sollten, aber nicht zur Nachahmung empfohlen wurden. Mit der oben erwähnten Tieraussonderung durch die Religionsgeschichte ging eine Delegation der Ekstasebereitschaft auf Spezialisten, insbesondere den Religionsstifter selbst einher. Hans Peter Dürr sprach in diesem Zusammenhang von „Religion aus zweiter Hand“; in den Heiligen Schriften stehen nachzulesende Besessenheiten und eben kaum noch Tiermächte. Fällt ein Monotheist zurück in die Nähe der Tierschicht, gilt er als „Schwarmgeist“ und Verräter am menschlichen Fortschritt vom Mythos zum Logos, von der Heteronomie zur Autonomie, von der Naturabhängigkeit zur Naturbeherrschung.
Die Heteronomie der Besessenen wird häufig in die Metapher von Pferd und Reiter gekleidet. Der Mensch wird zum Reittier, das Tier zum Reiter. Noch bei Luther – in seinem Kampf gegen die Lehre des Erasmus von der Willensfreiheit – wird der Mensch entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Oft kämpfen die beiden rivalisierenden Reiter, „um das Reittier zu ergreifen und zu besitzen“. Nach Benz bedeutete in der Antike die Epilepsie, d.h. die „Ergriffenheit“, die „heilige Krankheit“. In der christlichen Mystik wird daraus ein gegenseitiges Ergreifen und Ergriffenwerden zwischen Mensch und Gottheit, so wie es wohl auch in der uralten Tierschicht vorgedacht war.
Schluss
Bekanntlich verbot Kaiser Josef II. (1741-1790) die Ausübung des Exorzismus, der nach 50 Zeugnissen in den Evangelien vom Heiland selbst durchgeführt wurde, im gesamten Römischen Reich Deutscher Nation – vergeblich. Die Besessenheiten und ihre Diagnose als Teufelswerk verbreiteten sich auch in der Neuzeit weltweit. Gläubige Kenner führen das u.a. auf die erneute Behinderung der Teufelsaustreibung z.B. durch das Zweite Vatikanische Konzil zurück. Für Ethnologen sind das alles Belege für die Unbesiegbarkeit der Tierschicht und des Glaubens an die Heteronomie des menschlichen Subjekts. Dieses scheint im wahrsten Wortsinn ein „Unterworfenes“ zu sein, gleich ob die Besitz ergreifende Macht ein bekanntes Tier, ein fantastisches Fabeltier, ein irritierendes Mischwesen oder ein angsteinflößender Dämon ist. Oft wird in der besitzergreifenden Macht alles zusammengeworfen, was auf der offiziellen Bühne des Gesellschaftstheaters verboten oder verpönt ist, wie das z.B. Maria Elisabeth Thiele in ihrer trefflichen Studie über den brasilianischen Pombagira-Kult nachzeichnen konnte. Oder es kehren in der Besessenheit Tote wieder, wie es Thomas Hauschild im modernen Italien erfahren konnte. In beiden Fällen kann auf Tiersymbolik nicht verzichtet werden, auch wenn dem allgemeinen zivilisatorischen Trend zufolge das Tier in den neuzeitlichen Formen von Hieromanie etwas zurückzutreten scheint – oder in anderer Gestalt wiederkehrt? Seit März 2020 erscheint die zusammengerückte Welt wie gelähmt durch die Wahrnehmung eines unsichtbaren Tieres, des mittlerweile alles beherrschenden Covid 19. Es wird ikonographisch als mit Pusteln übersäte Kugel bewältigt, bekam die majestätische Etikette „Corona“ verliehen und der bayrische Ministerpräsident Söder droht: „Corona verzeiht keinen Leichtsinn“. Und reitet am Horizont nicht auch längst der neue St. Georg mit der Impfspritze als Lanze zu Hilfe? Im Zeitalter der Elektronenmikroskope und der Digitalisierung des Lebens musste die nie besiegbare Tiermacht vielleicht zum mikrobiologischen Virus schrumpfen und als solches die im Fortschrittsglauben gebannte Menschheit zurückbannen – wieder mit unabsehbaren Folgen.
Ein Beitrag von Prof. Bernhard Streck
Bernhard Streck ist Professor für Ethnologie i. R. und lehrte u. a. an den Universitäten Gießen, Berlin, Mainz und Heidelberg. 1994-2010 war er Leiter des Instituts für Ethnologie der Universität Leipzig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen: Religionsethnologie, Fachgeschichte, Ethnographie Nordostafrikas und Tsiganologie. Zahlreiche Publikationen, u. a. „Sudan – Steinerne Gräber und lebendige Kulturen am Nil“ (1982), „Wörterbuch für Ethnologie“ (1987/2000), „Die Halab“ – Zigeuner am Nil (1996), „Fröhliche Wissenschaft Ethnologie“ (1997).
Der vollständige Artikel inkl. Anmerkungen und weiterführender Literatur ist erschienen in:
© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie und Edition Hamouda